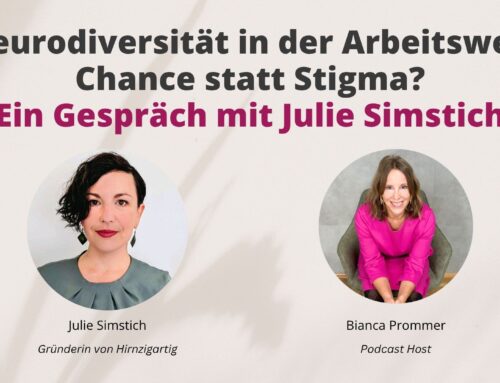Mehr als ein Netzwerk: Wie die Universität Bayreuth ein lebendiges Innovationsökosystem aufgebaut hat
Ein Netzwerk ist noch kein Innovationsökosystem.
Dieser Satz von David Eder bringt etwas auf den Punkt, das im Innovationsdiskurs oft übersehen wird.
Denn viele Organisationen verwechseln Austausch mit Zusammenarbeit – und Begegnung mit Co-Kreation.
Ein Innovationsökosystem entsteht nicht, weil sich Akteure regelmäßig treffen.
Es entsteht, wenn sie gemeinsam gestalten.
Wenn sie bereit sind, Wissen, Ressourcen und Verantwortung zu teilen.
In dieser Folge meines Podcasts Innovation Einfach Machen habe ich mit David Michael Eder, Transfer- und Innovationsmanager an der Universität Bayreuth, darüber gesprochen, wie man ein solches Ökosystem aufbaut – und was es braucht, damit es nicht nur lebt, sondern Wirkung entfaltet.
Das Interview gibt es in meinem Podcast „Innovation Einfach Machen“ anzuhören oder direkt auf YouTube.
Hinweis: Ein Gespräch mit David Eder – Blogbeitrag auf Basis der Podcastfolge „Innovation einfach machen“ mit Bianca Prommer wurde mithilfe von KI erstellt
Was ist ein Innovationsökosystem – und was nicht?
„Ein Netzwerk ist noch lange kein Innovationsökosystem.“
Diese Feststellung mag simpel klingen, sie beschreibt aber eine entscheidende Differenz.
Denn Netzwerke verbinden Menschen.
Innovationsökosysteme verbinden Absichten.
Ein Netzwerk ist eine Ansammlung von Kontakten, die sich austauschen, voneinander lernen und gelegentlich zusammenarbeiten.
Ein Innovationsökosystem ist ein System von Beziehungen, Rollen und Prozessen, das gezielt darauf ausgerichtet ist, Innovation zu ermöglichen und zu beschleunigen.
David Eder beschreibt das so:
„Ein Innovationsökosystem besteht im Wesentlichen aus vier Akteursgruppen – etablierten Unternehmen, Startups, Forschung und Bildung sowie Unterstützern. Erst im Zusammenspiel dieser Gruppen entsteht das eigentliche Innovationspotenzial.“
Das bedeutet:
Ein Ökosystem ist kein loser Verbund, sondern ein orchestriertes Zusammenspiel.
Und genau hier liegt die Herausforderung – und die Kunst.
Die Universität Bayreuth als Orchestrator
Die Universität Bayreuth hat früh erkannt, dass Forschung, Lehre und Transfer untrennbar miteinander verbunden sind.
Schon 2014 wurde die strategische Entscheidung getroffen, den Transfer als dritte Säule der Universität aufzubauen.
Seither ist rund um die Universität ein Ökosystem entstanden, das weit über den Campus hinausreicht.
David Eder war von Anfang an Teil dieser Entwicklung.
Heute arbeitet er am Institut für Entrepreneurship und Innovation, das eng mit regionalen Partnern vernetzt ist: mit den Hochschulen in Oberfranken, mit Fraunhofer-Zentren, Gründerzentren, Kammern, Startups und etablierten Unternehmen.
Ein fein abgestimmtes System, das auf Zusammenarbeit, Vertrauen und Kontinuität basiert.
„Wir sehen uns als Orchestrator“, sagt David. „Wie ein Dirigent, der weiß, wann welches Instrument spielt, damit am Ende ein stimmiges Stück entsteht.“
Dieses Bild trifft es.
Denn ein funktionierendes Innovationsökosystem braucht jemanden, der die Akteure zusammenbringt, Strukturen schafft und gleichzeitig Raum für Eigeninitiative lässt.
Nicht, um Kontrolle auszuüben – sondern um das Zusammenspiel zu ermöglichen.
Vom Aufbau zur Wirkung – elf Jahre Arbeit an einem lebendigen System
Die Geschichte des Innovationsökosystems der Universität Bayreuth zeigt, dass solche Systeme Zeit brauchen.
„Man muss einen langen Atem haben“, sagt David.
Und das spürt man in jedem Satz.
Der Aufbau begann mit einem kleinen Team, einem klaren Ziel und vielen Gesprächen.
Zunächst lag der Fokus auf der Universität selbst:
Studierende und Forschende sollten für Unternehmertum und Innovation sensibilisiert werden.
Es wurden Lehrveranstaltungen, Workshops und Netzwerke geschaffen, um eine erste Bewegung in Gang zu setzen.
Aus dieser Phase entstand eine Gründungs- und Innovationskultur, die heute in vier Lehrstühlen für Entrepreneurship verankert ist.
Ein sichtbares Ergebnis: Die Universität Bayreuth ist aktuell Platz 1 im Stifterverbandsranking unter den mittelgroßen Hochschulen – ein Zeichen dafür, dass das Ökosystem trägt.
Doch die wahre Stärke zeigt sich erst in der Öffnung nach außen.
Aus dem universitären Kern heraus entwickelte sich ein regionales Innovationsnetzwerk, das Startups, Unternehmen und Forschung verbindet.
Workshops, Events, Zukunftsschmieden und Labs wurden zu Katalysatoren einer Bewegung, die längst über die Universität hinaus Wirkung entfaltet.
Vertrauen als Fundament
Wenn man David zuhört, spürt man, wie oft in diesem Prozess das Wort „Vertrauen“ fällt.
Denn Vertrauen ist der eigentliche Rohstoff von Innovation.
„Innovation entsteht nur dort, wo Vertrauen da ist – Vertrauen, dass Ideen geteilt, ausprobiert und gemeinsam weiterentwickelt werden dürfen.“
Vertrauen bedeutet hier:
-
Wissen zu teilen, ohne Angst vor Verlust.
-
Gemeinsame Ziele zu verfolgen, statt nur eigene Interessen.
-
Erfolge miteinander zu feiern – und Fehler nicht zu bestrafen, sondern als Lernchancen zu sehen.
Dieses Vertrauen entsteht nicht durch Strategiepapier oder Leitlinie.
Es entsteht durch wiederkehrende Formate, durch Kontinuität und durch Beziehungen.
Die Universität Bayreuth schafft diese Räume gezielt – etwa über das Open Innovation Lab, über regelmäßige Community-Events oder über die „Zukunftsschmiede“, in der Unternehmen gemeinsam an Zukunftsthemen arbeiten.
Was dabei auffällt:
Das Ökosystem wächst nicht durch Größe, sondern durch Qualität der Beziehungen.
Je stabiler das Vertrauen zwischen den Akteuren, desto mutiger die Experimente – und desto höher die Innovationsgeschwindigkeit.
Der Orchestrator als Brückenbauer
David beschreibt seine Rolle im Ökosystem mit einem faszinierenden Bild:
Er sieht sich als Dirigent eines Orchesters.
Das klingt poetisch, ist aber hochpraktisch.
Denn genau darum geht es im Innovationsmanagement:
die richtige Besetzung zur richtigen Zeit,
mit einem gemeinsamen Ziel,
aber unterschiedlichen Stimmen.
„Manchmal fühle ich mich wie ein Dirigent bei einem Orchester“, sagt David. „Ich weiß nicht immer, wie das Stück endet – aber ich sorge dafür, dass alle im Takt bleiben und das Stück gemeinsam entsteht.“
Das bedeutet auch:
Ein Orchestrator entscheidet nicht, was gespielt wird – sondern wie gespielt wird.
Er koordiniert, übersetzt, verbindet.
Er schafft Strukturen, in denen Selbstorganisation entstehen kann.
Und genau das unterscheidet erfolgreiche Innovationsökosysteme von theoretischen Modellen:
Sie sind nicht linear, sondern lebendig.
Sie entwickeln sich in Iterationen, reagieren auf Impulse, lernen ständig dazu.
Wie ein Orchester in Bewegung.
Finanzierung – zwischen Förderung und Verstetigung
Ein Thema, das oft unterschätzt wird, ist die Finanzierung.
Denn der Aufbau eines Innovationsökosystems kostet Zeit, Energie und Geld.
In Bayreuth wurde der Start durch öffentliche Mittel ermöglicht – kombiniert mit eingeworbenen privaten Ressourcen.
Doch die größere Herausforderung liegt in der Verstetigung.
„Wenn ein Ökosystem nur aus einer Projektlogik heraus funktioniert, bricht es mit Ende der Förderung einfach weg“, sagt David. „Man muss Wege finden, wie es sich langfristig trägt.“
Dazu braucht es eine kritische Masse an Akteuren, die den Nutzen erkannt haben – und bereit sind, etwas zurückzugeben.
Finanzierung im Ökosystem ist also kein einseitiger Transfer, sondern ein gegenseitiger Austausch von Ressourcen.
Das kann finanziell sein, aber auch ideell, räumlich oder personell.
Wenn Akteure verstehen, dass ihr eigener Erfolg vom gemeinsamen Erfolg abhängt, entsteht Nachhaltigkeit.
Und genau hier liegt der Unterschied zwischen „Förderprojekt“ und „Ökosystem“:
Ein Projekt endet, ein Ökosystem wächst weiter.
Kommunikation – der oft übersehene Erfolgsfaktor
Neben Vertrauen und Finanzierung gibt es einen dritten Faktor, den David besonders betont: Kommunikation.
„Man ist im Alltag so stark mit Innovation beschäftigt, dass man manchmal vergisst, darüber zu sprechen.“
Erfolgsgeschichten sichtbar zu machen, Akteure zu verbinden, Feedback einzuholen – all das schafft Identität im Ökosystem.
Es geht nicht darum, Marketing zu betreiben, sondern Sinn zu stiften.
Denn Kommunikation ist das, was ein Ökosystem nach außen zusammenhält und nach innen lebendig macht.
Sie schafft Anschlussfähigkeit – lokal, national, international.
Und sie trägt dazu bei, dass sich aus einzelnen Initiativen ein gemeinsames Narrativ entwickelt.
Vom lokalen Netzwerk zur lernenden Region
Was in Bayreuth entsteht, ist mehr als ein Campusprojekt.
Es ist ein Modell für regionale Innovationsentwicklung.
Die Universität ist nicht nur Akteur, sondern Katalysator.
Sie bringt Unternehmen, Startups, öffentliche Institutionen und Forschung zusammen – nicht als Dienstleister, sondern als Mitgestalter.
Die Folge:
Oberfranken wird zu einer Region, in der Innovation nicht zentralisiert, sondern dezentral ermöglicht wird.
Eine Region, in der Kooperation stärker wiegt als Konkurrenz.
Und in der Hochschulen zu aktiven Partnern wirtschaftlicher Transformation werden.
Leuchttürme und Lernkurven
Natürlich ist nicht alles einfach.
Der Aufbau eines Innovationsökosystems ist ein Prozess voller Lernschleifen.
Kommunikation, Rollenverständnis, Ressourcen – all das musste in Bayreuth Schritt für Schritt entwickelt werden.
Manches hat funktioniert, manches nicht.
Doch entscheidend ist:
Fehler werden hier nicht als Rückschritte betrachtet, sondern als Erkenntnisse.
Und genau das unterscheidet ein lebendiges Ökosystem von einer Organisation, die Innovation nur proklamiert.
„Wir haben vieles richtig gemacht“, sagt David. „Aber wir haben auch gelernt, dass man Kommunikation, Sichtbarkeit und Beteiligung von Anfang an mitdenken muss. Und dass Mut und langfristige Perspektive wichtiger sind als der schnelle Erfolg.“
Warum wir mehr Innovationsökosysteme brauchen
Deutschland und Österreich stehen vor gewaltigen Transformationsaufgaben: Digitalisierung, Energiewende, Fachkräftemangel, demografischer Wandel.
Kein Unternehmen, keine Hochschule, keine Organisation kann diese Herausforderungen allein lösen.
Wir brauchen Orte, an denen Wissen geteilt, Ideen vernetzt und Lösungen gemeinsam entwickelt werden.
Orte, an denen Innovation kein Zufall ist, sondern System.
Innovationsökosysteme bieten genau das:
eine Struktur, die Vielfalt integriert, Ressourcen bündelt und Innovation ermöglicht – quer über Disziplinen, Branchen und Institutionen hinweg.
Doch dafür müssen wir verstehen:
Ein Ökosystem entsteht nicht durch Beschluss, sondern durch Beziehung.
Es braucht Menschen, die Brücken bauen, Räume öffnen und bereit sind, auch unbequeme Fragen zu stellen.
Innovationsökosysteme – ein Fazit
Ein funktionierendes Innovationsökosystem ist kein Zufallsprodukt und keine kurzfristige Initiative.
Es ist ein System von Beziehungen, Prozessen und Prinzipien – getragen von Menschen, die bereit sind, gemeinsam zu gestalten.
Die Universität Bayreuth zeigt, wie das gelingen kann:
Mit strategischer Klarheit, Vertrauen, Kontinuität und Mut.
Mit der Bereitschaft, über Disziplinen hinaus zu denken – und die Zukunft als gemeinsames Projekt zu begreifen.
Denn Innovation entsteht dort,
wo Menschen einander zuhören,
wo sie Verantwortung teilen,
und wo sie – wie in Bayreuth – den Mut haben, aus einem Netzwerk ein lebendiges Ökosystem zu machen.