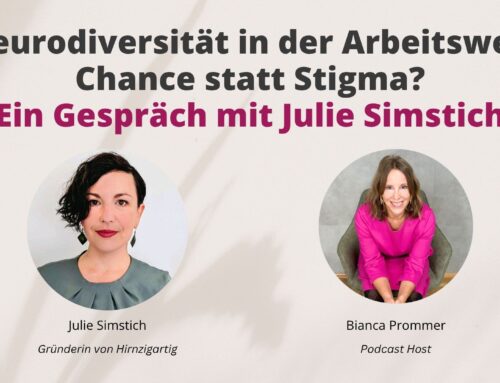Europa will innovativer werden. Endlich.
Mit dem EU Innovation Act setzt die Europäische Kommission ein deutliches Signal: Wir wollen Forschung und Ideen schneller in die Umsetzung bringen. Wir wollen, dass Start-ups wachsen. Wir wollen Innovationskraft.
Doch während die Ambition stimmt, bleibt eine zentrale Frage offen:
Wie gelingt Innovation in einem regulierten Raum, ohne dass Regeln zur Innovationsbremse werden?
Genau hier beginnt die Relevanz von ISO 56001 – der neuen internationalen Norm für Innovationsmanagementsysteme. Denn wer über Zukunft spricht, muss auch über Strukturen sprechen, die diese Zukunft ermöglichen.
EU Innovation Act & ISO 56001: Warum wir jetzt systemisch denken müssen
Der EU Innovation Act ist Teil der im Mai 2025 verabschiedeten Start-up- und Scale-up-Strategie der EU. Es geht um nicht weniger als den Versuch, Europa wieder zu einem führenden Innovationsstandort zu machen. Und die Ziele sind auf dem Papier durchaus überzeugend:
-
Bessere Rahmenbedingungen für den Transfer von Forschung in den Markt
-
Sektorenübergreifende Förderung von Innovation
-
Leichterer Zugang zu Finanzierung, Infrastruktur, Talenten
-
Unterstützung für Start-ups und Scale-ups
-
Schließung der europäischen Innovationslücke
Das alles ist gut. Und dringend nötig. Denn während die USA und China längst in Innovationsgeschwindigkeit denken, stecken europäische Unternehmen oft im Labyrinth aus Vorgaben, Prüfverfahren und Förderlogiken fest.
Aber: Ein neues Gesetz allein wird die Probleme nicht lösen.
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Wo der Innovation Act ins Stolpern kommt
Als Beraterin für Innovationskultur erlebe ich es fast täglich: Unternehmen wollen. Sie sind bereit. Sie haben Ideen. Was sie oft nicht haben, ist Klarheit. Oder Luft zum Atmen.
Und genau da liegt die größte Schwachstelle des EU Innovation Acts – trotz seiner guten Intentionen.
1. Überregulierung statt Ermöglichung?
Innovation lebt von Geschwindigkeit. Von Iteration. Von Mut. Wenn aber Regulierungen – so notwendig sie sein mögen – nicht flexibel genug sind, wird genau diese Dynamik abgewürgt. Vor allem junge Unternehmen schrecken vor hohen Compliance-Kosten und komplexen Genehmigungswegen zurück. Und das mit gutem Grund: Wer will schon mitten in der Ideenphase mit einem 159.000-Euro-Budgetposten für Risikozertifizierung jonglieren?
2. Unklare Definitionen, noch unklarere Konsequenzen
Was genau ist eine „hochriskante Innovation“? Wo liegt die Grenze? Und wer entscheidet das?
Solange diese Fragen offen bleiben, entsteht Unsicherheit – und Unsicherheit ist der natürliche Feind jeder unternehmerischen Entscheidung.
3. Bürokratische Hürden für KMU
Der Großteil der europäischen Wirtschaft besteht aus kleinen und mittleren Unternehmen. Wenn gerade diese Unternehmen durch zusätzliche Bürokratie und Dokumentationspflichten überfordert werden, verfehlt das Gesetz seine Wirkung. Innovation darf keine Frage von Ressourcen sein.
4. Gesetzgebung im Schneckentempo, Technologie im Sprint
Die technologische Entwicklung ist exponentiell – die Gesetzgebung nicht. Das ist kein neues Phänomen. Aber es ist eines, das sich im Innovationsbereich besonders schmerzhaft zeigt. Regelungen, die heute beschlossen werden, sind morgen womöglich schon veraltet.
5. Fragmentierung durch Parallelregulierungen
AI Act. Data Act. Innovation Act. Förderregularien. Compliance-Richtlinien.
Wer sich mit Innovationsvorhaben im EU-Kontext befasst, muss nicht nur Innovationsmanager:in, sondern auch Jurist:in, Förderexperte:in und Bürokratieprofi sein. Das lähmt. Vor allem dort, wo wir eigentlich Beweglichkeit brauchen.
Der Hebel liegt im System: Warum die ISO 56001 auch für den EU Innovation Act relevant ist
Und hier kommt die ISO 56001 ins Spiel.
Die internationale Norm für Innovationsmanagementsysteme schafft das, was der EU Innovation Act (noch) nicht leistet: einen strukturierten, praxistauglichen Rahmen für Innovationsprozesse in Organisationen jeder Größe.
Statt Ideen durch Regelwerke auszubremsen, bietet ISO 56001 Orientierung. Sie ist keine Innovationsmaschine, aber sie hilft, den Maschinenraum aufzuräumen.
1. Weniger Unsicherheit, mehr Klarheit
Einer der größten Vorteile: ISO 56001 bietet ein einheitliches Begriffsverständnis. Keine schwammigen Definitionen, keine willkürlichen Abgrenzungen. Stattdessen: klare Prozesse, strukturierte Entscheidungswege, transparente Kriterien. Für alle, die heute in innovationsgetriebene Projekte investieren, ist das Gold wert.
Und auch im Dialog mit Behörden oder Zertifizierungsstellen schafft die Norm einen messbaren Vorteil: Wer ISO-konform arbeitet, kann das nachweisen. Das reduziert Interpretationsspielräume – und schützt vor unnötigem Mehraufwand.
2. Nachweisbare Compliance durch Zertifizierung
Unternehmen, die nach ISO 56001 arbeiten, können sich zertifizieren lassen. Das heißt: Sie können regulatorischen Stellen gegenüber belegen, dass ihre Innovationsprozesse nicht nur kreativ, sondern auch regelkonform sind. Im Kontext des EU Innovation Acts ist das ein strategischer Vorteil – und möglicherweise auch künftig eine Voraussetzung für bestimmte Förderungen oder Zulassungsverfahren.
3. Flexibel, iterativ, anschlussfähig
ISO 56001 ist keine starre Norm. Im Gegenteil. Sie baut auf kontinuierlicher Verbesserung auf. Integrierte Feedbackzyklen und Audits sorgen dafür, dass das System mitwächst – mit der Organisation, mit der Technologie, mit der Welt. Genau diese Dynamik brauchen wir, wenn wir Innovation langfristig ermöglichen wollen.
Und: Die Norm ist anschlussfähig. Wer bereits ISO 9001 oder ISO 14001 nutzt, kann ISO 56001 problemlos integrieren. Das spart Ressourcen und erleichtert den Einstieg – gerade für KMU.
4. Innovationskultur und Führung im Fokus
Was viele unterschätzen: ISO 56001 ist keine rein technische Norm. Sie stellt explizit die Rolle von Führung und Unternehmenskultur in den Mittelpunkt. Denn ohne Vertrauen, Mut und Offenheit entsteht keine nachhaltige Innovation.
Die Norm fördert ein innovationsfreundliches Mindset – strukturell verankert und nicht nur in schönen Visionstatements.
Und was heißt das konkret für Unternehmen?
In meiner Arbeit mit Innovationsverantwortlichen und Führungsteams stelle ich oft eine Schlüsselfrage: Wie viel Innovationsenergie geht in eurer Organisation durch Reibung verloren?
Die Antworten sind ernüchternd. Und meistens unnötig.
Der EU Innovation Act macht deutlich: Die Zukunft gehört denen, die Innovation systematisch betreiben. Die Struktur mit Kreativität verbinden. Und die sich nicht zwischen Ideenreichtum und Compliance entscheiden müssen.
ISO 56001 ist dafür ein konkretes Werkzeug. Eines, das hilft, in der Komplexität den Überblick zu behalten – und gleichzeitig die Innovationskraft zu steigern.
Warum mich das Thema persönlich bewegt
Ich glaube nicht an Innovationskultur als Buzzword. Ich glaube an sie als Teil von echter Arbeit.
Der EU Innovation Act ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber er wird nur wirken, wenn wir gleichzeitig an der Umsetzungsfähigkeit in den Organisationen arbeiten.
Und dazu gehört:
-
Klarheit über Prozesse
-
Verlässliche Begriffe
-
Verankerung in der Führung
-
Integration ins Tagesgeschäft
-
Praktische Anwendbarkeit – auch für KMU
ISO 56001 ist kein Wundermittel. Aber sie ist ein starker Hebel.
Wenn wir sie klug nutzen, können wir nicht nur die Anforderungen des EU Innovation Acts erfüllen – sondern auch die Innovationskraft in Europa nachhaltig stärken.
Fazit: Innovation braucht Regeln. Aber die richtigen.
Der EU Innovation Act will Innovation ermöglichen. ISO 56001 zeigt, wie das gehen kann.
Der Schlüssel liegt in der Verbindung von politischer Rahmensetzung und organisationaler Umsetzungskompetenz. Unternehmen brauchen keine weiteren Innovationsparolen – sie brauchen Strukturen, die Innovation ermöglichen, statt sie zu blockieren.
Deshalb mein Appell:
Lasst uns ISO 56001 nicht als Bürokratiemonster betrachten, sondern als strategisches Werkzeug.
Für mehr Klarheit. Mehr Wirksamkeit. Und mehr echte Innovation – made in Europe.