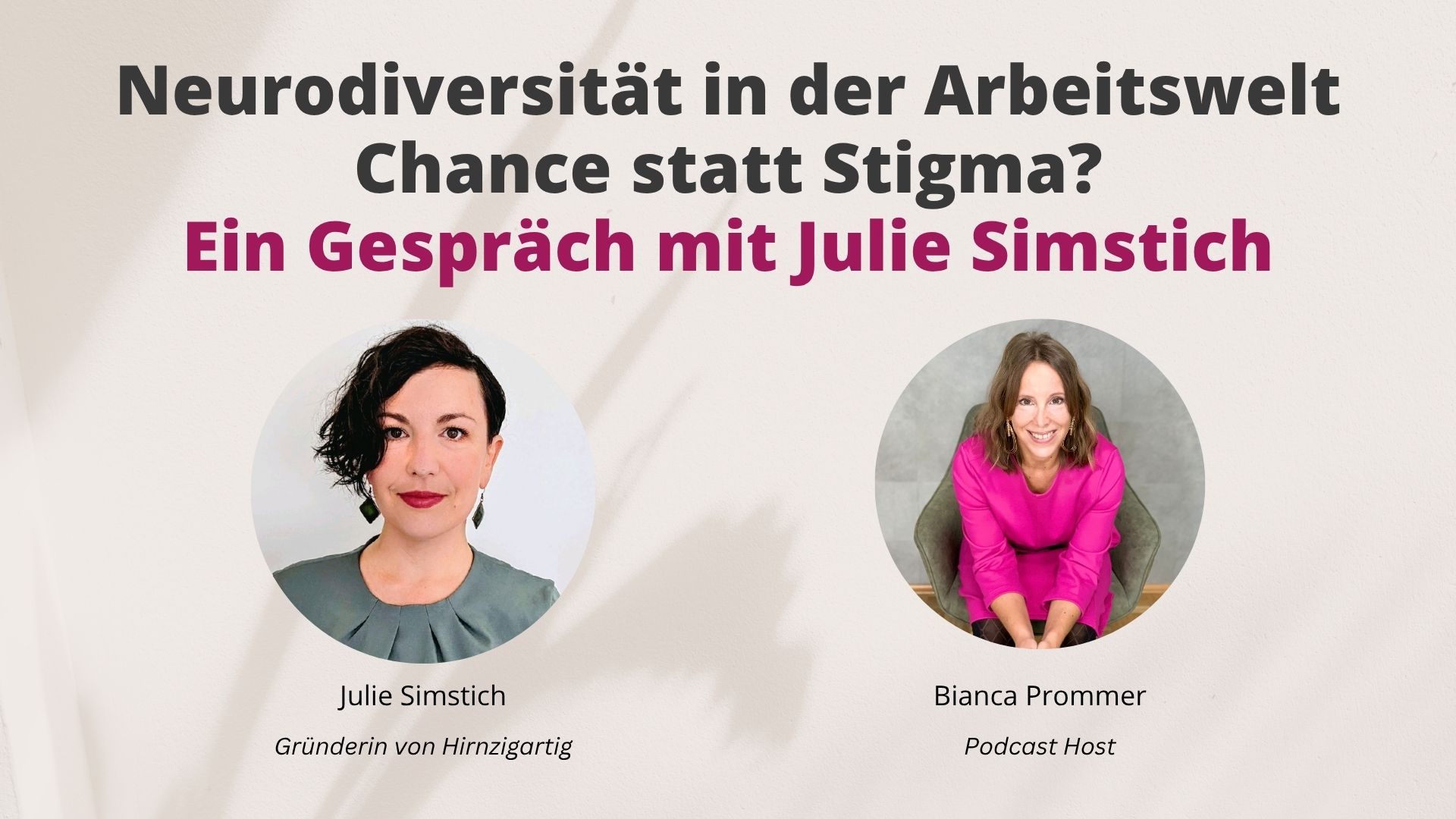Neurodiversität als Innovationsmotor: Warum Organisationen Vielfalt im Denken brauchen
In der Innovationswelt sprechen wir oft über Diversität: Unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Hintergründe sollen helfen, komplexe Probleme zu lösen und neue Ideen zu entwickeln. Was dabei jedoch oft ausgeblendet wird, ist ein Aspekt, der in vielen Organisationen noch unter dem Radar läuft: neurodiverse Denkweisen.
In der aktuellen Podcastfolge von „Innovation einfach machen“ spricht Bianca Prommer mit Julie Simstich, Expertin für Neurodiversität in der Arbeitswelt, über das enorme Potenzial neurodivergenter Menschen für Innovation. Der Blogbeitrag fasst zentrale Erkenntnisse, Impulse und Praxistipps aus dem Gespräch zusammen – für alle, die Innovation ganzheitlich denken wollen.
Das Interview gibt es in meines „Innovation Einfach Machen“ Podcasts anhören oder direkt auf YouTube.
Hinweis: Ein Gespräch mit Julie Simstich – Blogbeitrag auf Basis der Podcastfolge „Innovation einfach machen“ mit Bianca Prommer
Was bedeutet Neurodiversität eigentlich?
Der Begriff „Neurodiversität“ beschreibt die Vielfalt neurologischer Funktionsweisen. Julie Simstich erklärt, dass damit Unterschiede im Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Verarbeiten gemeint sind. Dazu zählen z. B. Autismus, ADHS, Legasthenie, Dyspraxie oder Hochsensibilität. Es geht dabei nicht um Krankheiten oder Defizite, sondern um natürliche neurologische Unterschiede, die Teil der menschlichen Vielfalt sind.
Julie beschreibt Neurodiversität als ein Spektrum: „Jeder Mensch denkt anders. Neurodivergente Menschen weichen einfach weiter von der gesellschaftlich normierten Denkweise ab.“ Diese Abweichung sei jedoch keine Schwäche, sondern könne in bestimmten Kontexten zu besonderen Stärken führen – gerade in der Innovation.
Innovation entsteht durch Abweichung
Ein zentrales Argument der Folge: Innovationen entstehen nicht durch Konformität, sondern durch Abweichung. Menschen, die anders denken, stellen bestehende Muster infrage, bringen ungewöhnliche Lösungen ein oder erkennen Zusammenhänge, die anderen verborgen bleiben.
Julie Simstich hebt hervor, dass viele neurodivergente Menschen „quer“ oder assoziativ denken. Sie kombinieren Informationen anders, denken in Bildern oder in Systemen. Genau das brauche es, wenn Unternehmen neue Wege gehen wollen: Nicht mehr vom Bestehenden aus denken, sondern aus anderen Blickwinkeln.
Diese Vielfalt im Denken sei nicht nur „nett zu haben“, sondern ein wirtschaftlicher Vorteil. Studien belegen, dass diverse Teams kreativere, robustere Lösungen entwickeln – wenn die Vielfalt nicht nur vorhanden, sondern auch integriert wird.
Zwischen Stärke und Anpassungsdruck: Herausforderungen im Arbeitsalltag
Trotz des Potenzials erleben viele neurodivergente Menschen im Arbeitskontext erhebliche Hürden. Julie nennt hier beispielhaft:
- Unklare oder widersprüchliche Kommunikation, die Menschen mit Autismus oder ADHS vor große Herausforderungen stellt.
- Sinnesreize im Büro, die für Hochsensible oder Autisten überfordernd sein können.
- Recruitingprozesse, die auf Extrovertiertheit, Selbstvermarktung oder spontane Interaktion setzen und damit viele Talente ausschließen.
Hinzu kommt ein hoher Anpassungsdruck. Viele neurodivergente Menschen haben früh gelernt, sich anzupassen, „mitzuspielen“ oder ihre Besonderheiten zu maskieren. Das kostet Energie, erzeugt Stress und verhindert, dass ihre Stärken sichtbar werden.
Das Fazit: Nicht das Anderssein ist das Problem, sondern das Umfeld. Innovation braucht Rahmenbedingungen, die Vielfalt nicht nur zulassen, sondern aktiv fördern.
Neuroinklusive Innovationskultur gestalten: Was Organisationen tun können
Was braucht es also, um eine neuroinklusive Innovationskultur zu schaffen? Julie und Bianca teilen im Gespräch konkrete Impulse:
- Sichtbarkeit und Sprache schaffen
Neurodiversität muss benennbar und enttabuisiert sein. Wer im Unternehmen darüber sprechen darf, ohne Scham oder Stigmatisierung, öffnet den Raum für andere. - Universal Design fördern
Statt individuelle Ausnahmen zu schaffen, lohnt es sich, Prozesse und Arbeitsweisen grundsätzlich inklusiver zu gestalten. Klare Kommunikation, flexible Arbeitsorte oder asynchrone Kollaboration helfen nicht nur neurodivergenten Menschen, sondern allen. - Rollenvielfalt in Teams ermöglichen
Nicht jede:r muss im Workshop gleich laut sein oder Ideen vor der Gruppe pitchen. Methoden wie Brainwriting, Einzelreflexion oder Pair-Work helfen, unterschiedliche Denkstile sichtbar zu machen. - Bewusstsein bei Führungskräften schaffen
Neurodivergente Mitarbeitende brauchen oft keine Sonderbehandlung, sondern Klarheit, Fairness und Flexibilität. Wer als Führungskraft Haltung zeigt und Offenheit lebt, setzt ein wichtiges Signal. - Stärkenorientierte Innovationsprozesse gestalten
Menschen mit ADHS bringen z. B. hohe Kreativität, Tempo und Energie ein, während Autist:innen Muster erkennen, systematisch denken und Probleme tief durchdringen. Innovation lebt von genau dieser Komplementarität.
Der Weg ist auch politisch: Warum Inklusion mehr ist als „Nice to have“
Julie macht deutlich, dass neuroinklusive Innovation kein Trendthema, sondern ein gesellschaftliches Anliegen ist. Es geht um Teilhabe, Chancengleichheit und wirtschaftliche Resilienz. Wer nur homogene Teams fördert, verliert wertvolle Perspektiven und läuft Gefahr, in blinden Flecken zu verharren.
Dabei heißt Inklusion nicht, dass alle alles gleich gut können müssen. Sondern dass alle ihre Stärken einbringen dürfen. Gerade in einer komplexen, unsicheren Welt sind ungewöhnliche Ideen, neue Denkansätze und „andere“ Sichtweisen keine Ausnahme, sondern Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit.
Julie bringt es auf den Punkt: „Wenn wir sagen, wir wollen Innovation, müssen wir Vielfalt nicht nur akzeptieren, sondern feiern.“
Fazit: Innovation braucht neurodiverse Denkräume
Die Podcastfolge macht eindrucksvoll deutlich, dass neurodivergente Menschen oft genau die Fähigkeiten mitbringen, die in Innovationsprozessen gebraucht werden: originelle Ideen, unkonventionelle Wege, intensive Analyse oder hohe Kreativität. Doch damit dieses Potenzial wirken kann, braucht es ein Umfeld, das diese Vielfalt zulässt, sichtbar macht und bewusst integriert.
Für Innovationsverantwortliche, Führungskräfte und Teams bedeutet das: Es reicht nicht, Vielfalt zu fordern – sie muss auch gelebt werden. Neurodiversität darf kein Randthema mehr sein, sondern muss Teil einer inklusiven Innovationsstrategie sein.
Weiterführende Links & Ressourcen:
👉 Julie Simstich auf LinkedIn: LINK
👉 Website & Angebote von Julie: hirnzigartig.at